Dieser Artikel gehört zur Artikelsammlung Toxikologie.
Näheres dazu im Artikel Vergiftungen verständlich erklärt und was man dagegen tun kann.
Blausäure (chem. Cyanwasserstoff) ist vielen Menschen ein Begriff, auch deren Salze sind spätestens seit den Genoziden während des 2. Weltkriegs vielen Leuten bekannt als todbringende Substanzen. Trotzdem ist die Verwendung von diesen Substanzen in einigen Bereichen bis heute nicht wegzudenken. In der Goldgewinnung und Verarbeitung sowie in der chemischen Industrie sind Cyanide (Salze der Blausäure) wichtige Chemikalien.
Wie wirken Cyanide nun auf den Körper und warum sind diese so immens giftig?
Das Cyanid-Ion (CN-) bindet an Eisen-3+ Ionen (Fe3+) im Körper und verhindert durch Komplexbildung deren physiologische Funktion. Dabei ist wichtig zu wissen, dass sog. dreiwertiges Eisen im Körper vor allem in Enzymen, hierbei vor allen in Enzymen der Atmungskette vorkommt. Besonders zu erwähnen ist dabei das Enzym Cytochromoxidase, ohne das die Zellatmung nicht möglich ist.
Wird nun dieses Enzym durch die Cyanid-Ionen blockiert, erstickt die Zelle innerlich, obwohl ausreichend Sauerstoff vorhanden wäre, dieser aber nicht verstoffwechselt bzw. innerhalb der Zelle transportiert werden kann.
Genau diese Eigenschaft des Cyanid-Ions macht man sich zu nutze, indem man im Körper mehr Fe3+-Ionen zu Verfügung stellt, die das Cyanid binden sollen, bevor es das Eisen in der Atmungskette bindet. Dies geschieht mit dem Antidot 4-DMAP (4-Dimethylaminophenol. Dieses oxidiert das Eisen im Hämoglobin von der Oxidationsstufe +2 zur Oxidationsstufe +3 und stellt somit mehr dreiwertiges Eisen zu Verfügung. Hämoglobin indem das Eisen die Oxidationsstufe +3 hat, wird Methämoglobin genannt (MetHb). Dieses MetHb kann keinen Sauerstoff mehr transportieren. Da jedoch Eisen im Blut im Grammbereich vorkommt, in der Atmungskette in den Zellen jedoch nur im Milligramm Bereich vorkommt, ist dies der Verlust vom Hämoglobin für den Körper leichter zu verkraften, als der Verlust des Eisens in der Atmungskette.
Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass maximal 40% MetHb gebildet werden dürfen, damit der eigentliche Sauerstofftransport im Blut nicht zu sehr eingeschränkt wird.
Als Nebenwirkung kann der Patient eine Zyanose entwickeln.
Es ist essentiell beim Einsatz von 4-DMAP, dass zuvor abgeklärt wurde, ob eine Vergiftung mit MetHb-Bildnern und Kohlenmonoxid ausgeschlossen werden kann, da ansonsten zu wenig funktionierendes Hämoglobin im Körper zu Verfügung steht. 4-DMAP ist daher bei Misch-Intoxikationen mit Kohlenstoffmonoxid kontraindiziert. Als (teure) Alternative steht für diese Fälle Hydroxycobalamin (Cyanokit (R)) zu Verfügung, da dieses das Cyanid bindet, ohne jedoch verfügbares Hämoglobin im Körper zu reduzieren.
Sollte man 4-DMAP überdosiert haben oder ein anderer MetHb-Bildner als Gift wirken, so steht Methylenblau (Toloniumchlorid, Toluidinblau) als Antidot zu Verfügung, das MetHb wieder zu Hb reduziert.
Weiter gehts mim Artikel Vergiftungen mit Opioiden
Näheres dazu im Artikel Vergiftungen verständlich erklärt und was man dagegen tun kann.
Blausäure (chem. Cyanwasserstoff) ist vielen Menschen ein Begriff, auch deren Salze sind spätestens seit den Genoziden während des 2. Weltkriegs vielen Leuten bekannt als todbringende Substanzen. Trotzdem ist die Verwendung von diesen Substanzen in einigen Bereichen bis heute nicht wegzudenken. In der Goldgewinnung und Verarbeitung sowie in der chemischen Industrie sind Cyanide (Salze der Blausäure) wichtige Chemikalien.
Wie wirken Cyanide nun auf den Körper und warum sind diese so immens giftig?
Das Cyanid-Ion (CN-) bindet an Eisen-3+ Ionen (Fe3+) im Körper und verhindert durch Komplexbildung deren physiologische Funktion. Dabei ist wichtig zu wissen, dass sog. dreiwertiges Eisen im Körper vor allem in Enzymen, hierbei vor allen in Enzymen der Atmungskette vorkommt. Besonders zu erwähnen ist dabei das Enzym Cytochromoxidase, ohne das die Zellatmung nicht möglich ist.
Wird nun dieses Enzym durch die Cyanid-Ionen blockiert, erstickt die Zelle innerlich, obwohl ausreichend Sauerstoff vorhanden wäre, dieser aber nicht verstoffwechselt bzw. innerhalb der Zelle transportiert werden kann.
Genau diese Eigenschaft des Cyanid-Ions macht man sich zu nutze, indem man im Körper mehr Fe3+-Ionen zu Verfügung stellt, die das Cyanid binden sollen, bevor es das Eisen in der Atmungskette bindet. Dies geschieht mit dem Antidot 4-DMAP (4-Dimethylaminophenol. Dieses oxidiert das Eisen im Hämoglobin von der Oxidationsstufe +2 zur Oxidationsstufe +3 und stellt somit mehr dreiwertiges Eisen zu Verfügung. Hämoglobin indem das Eisen die Oxidationsstufe +3 hat, wird Methämoglobin genannt (MetHb). Dieses MetHb kann keinen Sauerstoff mehr transportieren. Da jedoch Eisen im Blut im Grammbereich vorkommt, in der Atmungskette in den Zellen jedoch nur im Milligramm Bereich vorkommt, ist dies der Verlust vom Hämoglobin für den Körper leichter zu verkraften, als der Verlust des Eisens in der Atmungskette.
Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass maximal 40% MetHb gebildet werden dürfen, damit der eigentliche Sauerstofftransport im Blut nicht zu sehr eingeschränkt wird.
Als Nebenwirkung kann der Patient eine Zyanose entwickeln.
Es ist essentiell beim Einsatz von 4-DMAP, dass zuvor abgeklärt wurde, ob eine Vergiftung mit MetHb-Bildnern und Kohlenmonoxid ausgeschlossen werden kann, da ansonsten zu wenig funktionierendes Hämoglobin im Körper zu Verfügung steht. 4-DMAP ist daher bei Misch-Intoxikationen mit Kohlenstoffmonoxid kontraindiziert. Als (teure) Alternative steht für diese Fälle Hydroxycobalamin (Cyanokit (R)) zu Verfügung, da dieses das Cyanid bindet, ohne jedoch verfügbares Hämoglobin im Körper zu reduzieren.
Sollte man 4-DMAP überdosiert haben oder ein anderer MetHb-Bildner als Gift wirken, so steht Methylenblau (Toloniumchlorid, Toluidinblau) als Antidot zu Verfügung, das MetHb wieder zu Hb reduziert.
Weiter gehts mim Artikel Vergiftungen mit Opioiden
Dieser Artikel gehört zur Artikelsammlung Toxikologie.
Näheres dazu im Artikel Vergiftungen verständlich erklärt und was man dagegen tun kann.
Kommen wir nun zum eigentlichen Thema: Vergifungen. Am besten beginnen wir, für den Rettungsdienst passend, mit einem Symptom. Dem anticholinergen Syndrom. Dieses zeichnet sich primär durch Tachykardie, heiße, gerötete Haut sowie eine geweitete Pupillen (Mydriasis) aus. Alles Effekte die durch den Sympathikus ausgelöst werden. Es wird also verständlich, dass der Parasympathikus an seiner bremsenden/beruhigenden Tätigkeit gehindert wurde und der Sympathikus die Kontrolle über die Organe hat. Wodurch passiert das nun?
Der Parasympathikus kann durch sog. Parasympatholytika gehemmt werden, diese können an die muscarinischen oder nicotinischen Acetylcholinrezeptoren binden, ohne jedoch dabei eine Reizweiterleitung auszulösen. Dadurch wird der Parasympathikus teilweise oder vollständig blockiert.
Dies geschieht zum Beispiel durch Alkohol, Tropanalkaloide (Atropin, Hyoscyamin), trizyklische Antidepressiva, GABA (Gamma-Amminobuttersäure) oder auch durch Anti-Histaminika (H-Reptoren-Blocker, Antiallergiemedikamente).
Als Antidot für so eine Vergiftung kommt Physostigmin (Med: Anticholium (R)) in Frage. Dieses ist ein reversibler Hemmer des Enzyms Acetylcholin-Esterase (AChE). Dieses Enzym spaltet den Neurotransmitter Acetylcholin im synaptischen Spalt, sodass es nicht mehr wirksam ist und der Parasympathikus nicht so stark erregt wird. Wird nun die AChE durch Physostigmin gehemmt, findet kein Abbau von ACh in synaptischen Spalt statt, die ACh-Konzentration steigt und das anticholinerge Syndrom wird damit bekämpft, indem der Parasympathikus wieder verstärkt erregt wird.
Auf die Dosierung möchte ich hier nicht weiter eingehen, da das zu weit gehen würde und für das Verständnis auch nicht von Relevanz ist.
Eine Übererregung des Sympathikus wurde nun geklärt, was ist aber, wenn der Parasympathikus überregt wird? Als Symptome hierbei würde man Schweißausbrüche, enge Pupillen (Miosis), Bradykardie, starker Speichel- und Tränenfluss, Muskelzuckungen, Erbrechen und schließlich Bewusstlosigkeit gefolgt von peripherer und zentraler Atemlähmung.
Dies Symptome können zum Beispiel bei Vergiftungen mit organischen Phosphorsäureestern (Schädlingsbekämpfungsmittel E605, Nervenkampfstoffe wie Sarin, Tabun oder VX) oder mit verschieden Pilzen (Risspilze oder Trichterlingen) auftreten.
Je nachdem welches Gift auf den Körper wirkt, kommt es zu einem anderen Effekt: Das Pilzgift Muskarin zum Beispiel wirkt auf die muskarinischen ACh-Rezeptoren und löst somit den gleichen Effekt aus wie ACh, ohne jedoch von der AChE abgebaut zu werden. Somit kommt es zu einer Dauererreung des Parasympathikus und den o.g. Symptomen.
Bei Vergiftungen mit organischen Phosphorsäureestern kommt es zu einer irreversiblen Hemmung der AChE und somit zu einem Überangebot an ACh, da dieses von der AChE nicht mehr abgebaut werden kann. Dies resultiert wiederum in einer Dauererregung des Parasympathikus.
Organische Phosphorsäureester sind starke Kontaktgifte, es ist daher unbedingt auf Selbstschutz zu achten! Um vor akzidentellen Vergiftungen zu schützen, sind Schädlingsbekämpfungsmittel stark blau eingefärbt. Hat ein Patient also blauen, schaumigen Auswurf vorm Mund und die o.g. Symtpome ist eine Vergiftung zumindest anzudenken. Weiters interessant ist, dass E 605 zwar verboten ist, jedoch auf vielen Bauernhöfen noch zu finden ist, da es noch Vorräte davon gibt, außerdem gibt es eine Menge anderer organischer Phosphorsäureester, die frei im Baumarkt verfügbar sind aber eine gleich oder ähnlich starke Giftwirkung aufweisen.
Um dem entgegen zu wirken ist ein Stoff nötig, der die Neurotransmitter (ACh oder Muskarin beispielsweise) von den Rezeptoren verdrängt, dabei selbst an die Rezeptoren bindet ohne jedoch einen Reiz dabei auszulösen oder weiterzuleiten. Dieser Stoff ist Atropin, ein Parasympatholytikum. Man sieht bereits: Was beim gesunden Menschen ein anticholinerges Syndrom auslöst, ist oftmals die einzige Rettung für einen vergifteten Menschen.
Besonders interessant dabei ist die Dosierung vom Atropin. Da dieses die Blut-Liquor-Schranke vergleichsweise langsam passiert, sind extrem hose Dosen von bis 100 mg Atropin als Bolus notwendig. Da es außerdem sehr schnell abgebaut wird im Körper, sind alle 10-15 Minuten Repitationen erforderlich. Dies führt zu einer möglichen Gesamttagesdosis von bis zu 15g(!!!). Vergleicht man das mit der notwendigen Menge bei einer gewöhnlichen Bradykardie, so ist das die 30 000 fache Menge!
Allgemein soll die Dosierung des Atropins an Hand von Herzfrequenz, Speichel-, Tränen-, und Schweiß-Fluss erfolgen, da diese Indikatoren für die parasympathische Aktivität darstellen.
Weiter gehts mim Artikel Vergiftungen mit Blausäure
Näheres dazu im Artikel Vergiftungen verständlich erklärt und was man dagegen tun kann.
Kommen wir nun zum eigentlichen Thema: Vergifungen. Am besten beginnen wir, für den Rettungsdienst passend, mit einem Symptom. Dem anticholinergen Syndrom. Dieses zeichnet sich primär durch Tachykardie, heiße, gerötete Haut sowie eine geweitete Pupillen (Mydriasis) aus. Alles Effekte die durch den Sympathikus ausgelöst werden. Es wird also verständlich, dass der Parasympathikus an seiner bremsenden/beruhigenden Tätigkeit gehindert wurde und der Sympathikus die Kontrolle über die Organe hat. Wodurch passiert das nun?
Der Parasympathikus kann durch sog. Parasympatholytika gehemmt werden, diese können an die muscarinischen oder nicotinischen Acetylcholinrezeptoren binden, ohne jedoch dabei eine Reizweiterleitung auszulösen. Dadurch wird der Parasympathikus teilweise oder vollständig blockiert.
Dies geschieht zum Beispiel durch Alkohol, Tropanalkaloide (Atropin, Hyoscyamin), trizyklische Antidepressiva, GABA (Gamma-Amminobuttersäure) oder auch durch Anti-Histaminika (H-Reptoren-Blocker, Antiallergiemedikamente).
Als Antidot für so eine Vergiftung kommt Physostigmin (Med: Anticholium (R)) in Frage. Dieses ist ein reversibler Hemmer des Enzyms Acetylcholin-Esterase (AChE). Dieses Enzym spaltet den Neurotransmitter Acetylcholin im synaptischen Spalt, sodass es nicht mehr wirksam ist und der Parasympathikus nicht so stark erregt wird. Wird nun die AChE durch Physostigmin gehemmt, findet kein Abbau von ACh in synaptischen Spalt statt, die ACh-Konzentration steigt und das anticholinerge Syndrom wird damit bekämpft, indem der Parasympathikus wieder verstärkt erregt wird.
Auf die Dosierung möchte ich hier nicht weiter eingehen, da das zu weit gehen würde und für das Verständnis auch nicht von Relevanz ist.
Eine Übererregung des Sympathikus wurde nun geklärt, was ist aber, wenn der Parasympathikus überregt wird? Als Symptome hierbei würde man Schweißausbrüche, enge Pupillen (Miosis), Bradykardie, starker Speichel- und Tränenfluss, Muskelzuckungen, Erbrechen und schließlich Bewusstlosigkeit gefolgt von peripherer und zentraler Atemlähmung.
Dies Symptome können zum Beispiel bei Vergiftungen mit organischen Phosphorsäureestern (Schädlingsbekämpfungsmittel E605, Nervenkampfstoffe wie Sarin, Tabun oder VX) oder mit verschieden Pilzen (Risspilze oder Trichterlingen) auftreten.
Je nachdem welches Gift auf den Körper wirkt, kommt es zu einem anderen Effekt: Das Pilzgift Muskarin zum Beispiel wirkt auf die muskarinischen ACh-Rezeptoren und löst somit den gleichen Effekt aus wie ACh, ohne jedoch von der AChE abgebaut zu werden. Somit kommt es zu einer Dauererreung des Parasympathikus und den o.g. Symptomen.
Bei Vergiftungen mit organischen Phosphorsäureestern kommt es zu einer irreversiblen Hemmung der AChE und somit zu einem Überangebot an ACh, da dieses von der AChE nicht mehr abgebaut werden kann. Dies resultiert wiederum in einer Dauererregung des Parasympathikus.
Organische Phosphorsäureester sind starke Kontaktgifte, es ist daher unbedingt auf Selbstschutz zu achten! Um vor akzidentellen Vergiftungen zu schützen, sind Schädlingsbekämpfungsmittel stark blau eingefärbt. Hat ein Patient also blauen, schaumigen Auswurf vorm Mund und die o.g. Symtpome ist eine Vergiftung zumindest anzudenken. Weiters interessant ist, dass E 605 zwar verboten ist, jedoch auf vielen Bauernhöfen noch zu finden ist, da es noch Vorräte davon gibt, außerdem gibt es eine Menge anderer organischer Phosphorsäureester, die frei im Baumarkt verfügbar sind aber eine gleich oder ähnlich starke Giftwirkung aufweisen.
Um dem entgegen zu wirken ist ein Stoff nötig, der die Neurotransmitter (ACh oder Muskarin beispielsweise) von den Rezeptoren verdrängt, dabei selbst an die Rezeptoren bindet ohne jedoch einen Reiz dabei auszulösen oder weiterzuleiten. Dieser Stoff ist Atropin, ein Parasympatholytikum. Man sieht bereits: Was beim gesunden Menschen ein anticholinerges Syndrom auslöst, ist oftmals die einzige Rettung für einen vergifteten Menschen.
Besonders interessant dabei ist die Dosierung vom Atropin. Da dieses die Blut-Liquor-Schranke vergleichsweise langsam passiert, sind extrem hose Dosen von bis 100 mg Atropin als Bolus notwendig. Da es außerdem sehr schnell abgebaut wird im Körper, sind alle 10-15 Minuten Repitationen erforderlich. Dies führt zu einer möglichen Gesamttagesdosis von bis zu 15g(!!!). Vergleicht man das mit der notwendigen Menge bei einer gewöhnlichen Bradykardie, so ist das die 30 000 fache Menge!
Allgemein soll die Dosierung des Atropins an Hand von Herzfrequenz, Speichel-, Tränen-, und Schweiß-Fluss erfolgen, da diese Indikatoren für die parasympathische Aktivität darstellen.
Weiter gehts mim Artikel Vergiftungen mit Blausäure
Wie den meisten bekannt ist erkannte schon Paracelsus, dass:
Dieser allgemein gültige Satz stimmt so auch heute noch, so sind viele bekannte Antidota selbst auch starke Gifte oder für gesunde Menschen zumindest ungesund. Ich möchte in diesem Blogeintrag auf ein paar Vergiftungen eingehen, die ich durch einen sehr guten Artikel in der Fachzeitschrift Rettungsdienst [1] und dem Buch Medikamente in der Notfallmedizin [2], welche beide vom Author Mathias Bastigkeit geschrieben wurden.
Um die Wirkung von Gift und Gegengift zu verstehen muss man sich zuallererst die Anatomie des Nervensystems vor Augen führen, besonders des vegetativen Nervensystems. Sympathikus und Parasympathikus sind Teile davon, die jeweils entgegengesetzte Wirkung auf die Organe des Körpers haben.
So erweitert der Sympathikus die Puppillen, erhöht Herzfrequenz, Blutdruck, Hautdurchblutung und erniedigt die Sekretation von Verdauungssäften und erniedigt ebenfalls die peristaltischen Bewegungen des Verdauungstraktes. Er kann auch als Stressnerv für Flucht und Angriff gesehen werden. Der Parasympathikus bewirkt genau das Gegenteil, er verkleinert die Pupillen, senkt Herzschlag, Blutdruck, Hautdurchblutung. Er steigert die Persistaltik und die Sekretation von Verdauungsenzymen wie Galle, Bauchspeichel und Speichel.
Sympathikus und Parasympathikus stehen im Gleichgewicht, sprich wird einer von beiden geschwächt, so wirkt der andere entsprechend Stärker auf den Körper.
Gesteuert werden die Nerven über sogenannte Neurotransmitter. Der wichtigste Neurotransmitter des Sympathikus ist Noradrenalin, beim Parasympathikus Acetylcholin. Das funktioniert, indem Neurotransmitter von den Synapsen in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden und am gegenüberliegenden Ende des synpatischen Spaltes auf Rezeptoren treffen, an denen sie spezifisch binden.
Nun kommt es darauf an, ob bei der Bindung eines Rezeptors durch ein Molekül ein Reiz ausgelöst/weitergeleitet wird, oder nicht. Wird ein Reiz weitergeleitet/ausgelöst so spricht man von einem Agonisten (Verstärker), wird beim Binden an den Rezeptor hingegen kein Reiz ausgelöst, der Rezeptor also blockiert, so spricht man von einem Antagonisten.
Man unterscheidet hierbei noch zwischen mehreren Antagonisten, auf die jedoch hier nicht weiter eingegangen werden soll.
Weiter gehts im Artikel Vergiftungen mit Parasympatholytika (Alkohol, Atropin, GABA, Anti-Histaminika) oder Parasympathomimetika (organische Phosphorsäureester, Gift-Pilze)
[1] M. Bastigkeit; Rettungsdienst; Antidote: Welche sind ein absolutes Muss für den Rettungsdienst; 34. Jahrgang; Februar 2011; S. 38ff
[2] M. Bastigkeit; Medikamente in der Notfallmedizin, Stumpf & Kossendey; Auflage: 7., überarbeitete Auflage. (25. März 2008)
Dieser allgemein gültige Satz stimmt so auch heute noch, so sind viele bekannte Antidota selbst auch starke Gifte oder für gesunde Menschen zumindest ungesund. Ich möchte in diesem Blogeintrag auf ein paar Vergiftungen eingehen, die ich durch einen sehr guten Artikel in der Fachzeitschrift Rettungsdienst [1] und dem Buch Medikamente in der Notfallmedizin [2], welche beide vom Author Mathias Bastigkeit geschrieben wurden.
Um die Wirkung von Gift und Gegengift zu verstehen muss man sich zuallererst die Anatomie des Nervensystems vor Augen führen, besonders des vegetativen Nervensystems. Sympathikus und Parasympathikus sind Teile davon, die jeweils entgegengesetzte Wirkung auf die Organe des Körpers haben.
So erweitert der Sympathikus die Puppillen, erhöht Herzfrequenz, Blutdruck, Hautdurchblutung und erniedigt die Sekretation von Verdauungssäften und erniedigt ebenfalls die peristaltischen Bewegungen des Verdauungstraktes. Er kann auch als Stressnerv für Flucht und Angriff gesehen werden. Der Parasympathikus bewirkt genau das Gegenteil, er verkleinert die Pupillen, senkt Herzschlag, Blutdruck, Hautdurchblutung. Er steigert die Persistaltik und die Sekretation von Verdauungsenzymen wie Galle, Bauchspeichel und Speichel.
Sympathikus und Parasympathikus stehen im Gleichgewicht, sprich wird einer von beiden geschwächt, so wirkt der andere entsprechend Stärker auf den Körper.
Gesteuert werden die Nerven über sogenannte Neurotransmitter. Der wichtigste Neurotransmitter des Sympathikus ist Noradrenalin, beim Parasympathikus Acetylcholin. Das funktioniert, indem Neurotransmitter von den Synapsen in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden und am gegenüberliegenden Ende des synpatischen Spaltes auf Rezeptoren treffen, an denen sie spezifisch binden.
Nun kommt es darauf an, ob bei der Bindung eines Rezeptors durch ein Molekül ein Reiz ausgelöst/weitergeleitet wird, oder nicht. Wird ein Reiz weitergeleitet/ausgelöst so spricht man von einem Agonisten (Verstärker), wird beim Binden an den Rezeptor hingegen kein Reiz ausgelöst, der Rezeptor also blockiert, so spricht man von einem Antagonisten.
Man unterscheidet hierbei noch zwischen mehreren Antagonisten, auf die jedoch hier nicht weiter eingegangen werden soll.
Weiter gehts im Artikel Vergiftungen mit Parasympatholytika (Alkohol, Atropin, GABA, Anti-Histaminika) oder Parasympathomimetika (organische Phosphorsäureester, Gift-Pilze)
[1] M. Bastigkeit; Rettungsdienst; Antidote: Welche sind ein absolutes Muss für den Rettungsdienst; 34. Jahrgang; Februar 2011; S. 38ff
[2] M. Bastigkeit; Medikamente in der Notfallmedizin, Stumpf & Kossendey; Auflage: 7., überarbeitete Auflage. (25. März 2008)
Bei der vielen Anatomie, die ich derzeit lerne, ist mir folgendes Video wieder eingefallen:
Eingeordnet unter: Notfallsanitaeter-Ausbildung, youtube, video.google.com, etc...
Heute war wieder einmal NFS-Kurs und am Plan stand Anatomie, genauer Hirn & Nervensystem. Drei Stunden intensiver Unterricht aber sehr gut vorgetragen. Hab viel neues gelernt und einiges bereits bekanntes wieder aufgefrischt. Anstrengend ja, aber gut. So soll Unterricht sein!
Bleibt mir nur noch zu sagen
Bleibt mir nur noch zu sagen
Eingeordnet unter: Notfallsanitaeter-Ausbildung
durften wir heute unser vorher angeeignetes Anatomiewissen über Herz und Kreislauf indem wir eine abgewandelte Form von Jeopardy gespielt haben. Zwei Gruppen mussten Fragen mit unterschiedlichen Punktwerten beantworten, wobei - im Unterschied zum Originalspiel - die Fragen gestellt worden und wir 37 Sekunden Zeit zum Antworten hatten.
Wir (mein Team) haben gewonnen.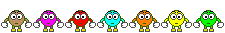
Und damit der Eintrag auch was sinnvolles hat: Wer weiß, was ein Herzohr ist?
Falls nein, Herzohr (Wikipedia).
Wir (mein Team) haben gewonnen.
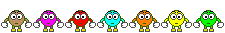
Und damit der Eintrag auch was sinnvolles hat: Wer weiß, was ein Herzohr ist?
Falls nein, Herzohr (Wikipedia).
Eingeordnet unter: Notfallsanitaeter-Ausbildung
Ich darf hiermit verkünden: Ich habe den Einsteigstest für den Notfallsanitäter-Kurs bestanden und bin somit ganz offiziell Notfallsanitäter in Ausbildung (NFSiA).
Der Aufnahmetest hat bestanden aus einem theoretischen Multiple-Choice Test über Anatomie, Physiologie, Krankheitsbilder und einigen anderen Bereichen des Rettungsdienstes. Anschließend musste je ein Fallbeispiel in den Kategorien Traumatologie, Interne Notfälle bzw. Chirurgische Notfälle sowie ein Kinder-/Säuglingsnotfall.
Das ganze war recht schnell erledigt und nach einer sehr ausführlichen Fragestunde (wir haben Fragen gestellt an die Modulleitung), wie, wo, was, wann abläuft wurden wir auch schon wieder entlassen.
Los gehts dann ab nächsten Dienstag, ganz klassisch mit "Erste Hilfe" :)
Der Aufnahmetest hat bestanden aus einem theoretischen Multiple-Choice Test über Anatomie, Physiologie, Krankheitsbilder und einigen anderen Bereichen des Rettungsdienstes. Anschließend musste je ein Fallbeispiel in den Kategorien Traumatologie, Interne Notfälle bzw. Chirurgische Notfälle sowie ein Kinder-/Säuglingsnotfall.
Das ganze war recht schnell erledigt und nach einer sehr ausführlichen Fragestunde (wir haben Fragen gestellt an die Modulleitung), wie, wo, was, wann abläuft wurden wir auch schon wieder entlassen.
Los gehts dann ab nächsten Dienstag, ganz klassisch mit "Erste Hilfe" :)
Eingeordnet unter: Notfallsanitaeter-Ausbildung, Rettung
